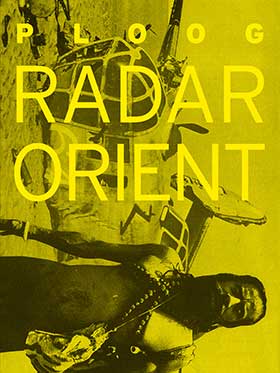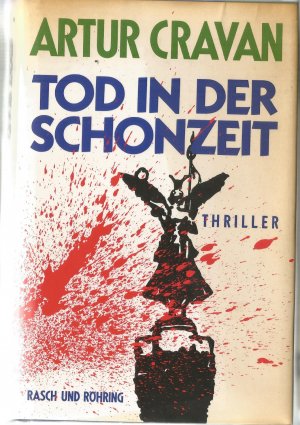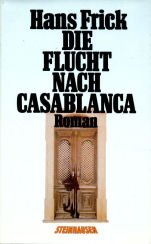„Sid Schlebrowski“ ist die Geschichte von zwei Kids, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Sid, der eigentlich Michael heißt, sich aber nach Sid Vicious von den Sex Pistols nennt, ist ein schüchterner, minderjähriger Provinzpunk mit einem saufenden Vater, der mal Boxer war. Nancy heißt wirklich so, ist auch erst sechzehn und stammt aus einer wohlhabenden Adelsfamilie. Der Roman spielt hauptsächlich im Sommer 1980 und beginnt, als Sid in den schwarzen Citroen steigt, den Nancy ihrem Vater geklaut hat, aber das ist nicht das richtige Wort, eigentlich war das eine Enteignungsaktion.
 Die beiden ziehen durch Süddeutschland, Österreich und Italien, logieren in Luxushotels und reisen ab, ohne zu bezahlen. Sie erleichtern Menschen, die es sich leisten können und die meistens auch einiges auf dem Kerbholz haben, um Geld, Schmuck und teure Klamotten. Unterwegs treffen sie immer wieder auf Menschen, die ihnen helfen: ein kommunistisches Ehepaar, das im spanischen Bürgerkrieg gekämpft hat oder einen Tankwart, der über den Tod seines Sohnes noch lange nicht hinweg ist und Fahrer einer bestimmten Automarke einfach nicht ausstehen kann, weshalb er Sid und Nancy davonkommen lässt, als sie auch an der Tankstelle das Bezahlen unterlassen. Das alles basiert auf einer alten Zeitungsmeldung, die Bittermann jahrzehntelang aufbewahrt hat, ist also so (oder so ähnlich) tatsächlich passiert.
Die beiden ziehen durch Süddeutschland, Österreich und Italien, logieren in Luxushotels und reisen ab, ohne zu bezahlen. Sie erleichtern Menschen, die es sich leisten können und die meistens auch einiges auf dem Kerbholz haben, um Geld, Schmuck und teure Klamotten. Unterwegs treffen sie immer wieder auf Menschen, die ihnen helfen: ein kommunistisches Ehepaar, das im spanischen Bürgerkrieg gekämpft hat oder einen Tankwart, der über den Tod seines Sohnes noch lange nicht hinweg ist und Fahrer einer bestimmten Automarke einfach nicht ausstehen kann, weshalb er Sid und Nancy davonkommen lässt, als sie auch an der Tankstelle das Bezahlen unterlassen. Das alles basiert auf einer alten Zeitungsmeldung, die Bittermann jahrzehntelang aufbewahrt hat, ist also so (oder so ähnlich) tatsächlich passiert.
Das Buch durchzieht ein steter Hauch von Anarchie. Bittermann hat ein großes Herz für die Ausgestoßenen, Nicht-Angepassten, die Outlaws. Man wird ganz wehmütig und möchte beim Lesen die ganze Zeit Udo Lindenberg singen, das Lied von den zwei Geflippten, die durch nichts zu bremsen sind, aber das wäre als musikalische Analogie vielleicht zu platt. Und deshalb ist ein zentrales Stück in diesem Buch „Searching for a heart“ von Warren Zevon: „Certain individuals aren’t sticking with the plan“. Das ist zwar von 1991, aber das Buch endet ja auch nicht in dem Jahr, in dem es angefangen hat. Und da Klaus Bittermann, obschon seit Äonen in Berlin ansässig, Anhänger des BVB ist, darf man auch noch vermuten, dass der Held seines Romans nicht zufällig den Namen von Elwin Schlebrowski trägt, einem Mitglied der Dortmunder Meistermannschaft von 1956.
Ein Buch, das einen nachdenken lässt, ob man nicht mal wieder ein teures Auto anzünden sollte. Muss ja nicht das eigene sein.“ (Ausblende Goosen)