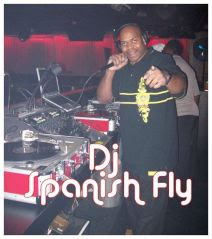TAUSCHWERTE
Von Franz Dobler | 2. Januar 2013 | Kategorie: Literatur | Kommentare deaktiviert für TAUSCHWERTEIn meinem naturgemäß abenteuerarmen „Poetenleben“, wie es Robert Walser schon damals viel zu romantisch nannte, war dies eines der aufregendsten Ereignisse, und mein Freund, der kroatische Autor Edo Popovic hat kürzlich dies darüber geschrieben:
„Und das wird’s wohl sein, was wir am Ende von unserer Arbeit gehabt haben werden. Ein paar gute Geschichten. Ein paar gute Leute.
Mit diesen Sätzen endet die Erzählung Zufall von Franz Dobler aus der Sammlung Letzte Stories. In dieser Erzählung geht es um die Begegnung zweier Schriftsteller auf einem Festival. Obwohl sie sich vorher nicht gekannt haben, zeigt die Erzählung, wie die beiden durch bestimmte Dinge verbunden sind, die nicht einmal von der verrücktesten Phantasie hätten erdacht werden können.
Ein ähnlicher Zufall wollte es, dass ich…“ Weiterlesen:
http://www.literaturportal-bayern.de/autorinnenblog?task=lpbblog.default&id=71
 Fotoquelle: Monitor.hr
Fotoquelle: Monitor.hr
Festival u počecima: Edo Popović i Roman Simić Bodrožić 2004 in ihrer kostbaren Freizeit. (Hvar)
BRECHTFESTIVAL AUGSBURG 2013 (3)
Von Franz Dobler | 2. Januar 2013 | Kategorie: Bildung, Literatur | Kommentare deaktiviert für BRECHTFESTIVAL AUGSBURG 2013 (3)Mit meinen Kindern im Jugendarrest habe ich schon mehrmals Brecht gelesen. Den „Augsburger Kreidekreis“ etwas gekürzt, weil unser Zeitfenster zu klein ist. Niemandem sagte der Name Brecht was. Aber wieso auch.
Gymnasiasten oder Studenten sind ganz selten dabei. Ein Hauptschulabschluss ist so ziemlich die Spitze und keinesfalls die Regel. Was nichts sagt. Nicht wenige von ihnen sind intelligent und streetwise. Oder haben sich irgendwoher von jenseits der Schule eine stattliche Menge Allgemeinbildung beschafft. Zu viele andere haben nichts und werden wohl nie was bekommen oder sich besorgen, da darf man sich nichts vormachen.
Die Leute in den Hauptschulen sind allen wurst. Alle laufen in die 7. Klassen der Gymnasien aufwärts und diskutieren über Goethe und Literatur und Brecht und den Sinn des ebooks in den Zeiten des nur scheinbar ehemaligen Rinderwahnsinns. Aber die Leute in den Hauptschulen sind allen vollkommen wurst. Die sollen die Schnauze halten und bei RTL-1 bloß die Schnauze halten. Ich sag euch was, ihr armen gestressten Lehrerbeamten und tapferen Mittelschichteltern: ihr werdet diese Sackgasse in eurem Gehirn eines Tages ganz bitter bereuen. Aber erst, wenn ihr die letzten Millionen in euren Brecht- und Wagner-Festspielen verbraten habt, wird euch vielleicht irgendwas dämmern.
Ich bin niemals auf eurer Seite – ich bin auf ihrer Seite.
Und den Vortrag, den ich euch zum Thema halten kann, findet ihr so unlustig wie euch überfordernd. Das Bildungsgut, das ihr mit euch herumschleppt, ist so mager und mickrig, dass ihr nur unter euresgleichen den Anschein erwecken könnt, damit was hermachen zu können. Vergesst es doch einfach und geht in´n nettes Lokal.
Außerdem habe ich aus den „Kalendergeschichten“ auch „Fragen eines lesender Arbeiters“, „Mein Bruder war ein Flieger“ und meine Lieblingsstory „Die unwürdige Greisin“ gelesen. Ich hatte immer den Eindruck, dass irgendwas von Brecht immer bei den Kandidaten ankam. Beim „Kreidekreis“ natürlich die Kriegssituation und die Frage, was eine Mutter ist, was eine gute, was eine schlechte… Das Duell am Ende versteht jeder, wenn auch nicht unbedingt sofort den eigentlichen Witz.
Unvergesslich und unbezahlbar die Bemerkung eines 18-Jährigen russischen Immigranten: „Also ich weiß nicht, warum ich mir das Zeug da von diesem Vogel Brecht da anhören soll, lesen Sie doch was von sich selber, wenn Sie schon sagen, dass Sie selber auch so Zeug schreiben, das fände ich dann echt interessanter.“
„Aber ich nicht.“
NILS KOPPRUCH (10)
Von Franz Dobler | 31. Dezember 2012 | Kategorie: Allgemein, Musik | Kommentare deaktiviert für NILS KOPPRUCH (10)Sehr schöne Sendung mit vielen Stimmen von Freunden/Begleitern:
http://www.ndr.de/info/audio142439.html
***
Flyer/Plakat: (c) ELHO/Toddn.
Von geplanten gemeinsamen Auftritten hatte nur einer stattgefunden, im Übel & Gefährlich in Hamburg. Die nächsten Konzerte spielen wir woanders.
„Werft uns in einen Fluss und wenn ihr Pech habt, ham wir Glück.“
Wir bitten unsere Abonnenten, diese Abbildung als spezielles Geschenk zum Ende dieses seltsamen Jahres zu verstehen. Mögen euch die Götter eurer Wahl auch im 13er Jahr beschützen und reich beschenken!
MEINE 2012 CHARTS
Von Franz Dobler | 31. Dezember 2012 | Kategorie: Lifestyle | Kommentare deaktiviert für MEINE 2012 CHARTSnannte ich mit reinem Gewissen der jungen Welt:
Alben
Kid Kopphausen: I (Trocadero)
Masha Qrella: Analogies (Morr)
Bernadette La Hengst: Integrier mich, Baby (Trikont)
Smokestack Lightnin´: Stolen Friends (Witchcraft International)
Becky Lee and Drunkfoot: Hallo Black Halo (Voodoo Rhythm)
Song des Jahres „Im Westen nichts Neues“ von Nils Koppruch/Kid Kopphausen
Hier das mehr als dreckige Dutzend der Kollegen btr. alle Künste:
http://www.jungewelt.de/2012/12-29/052.php?sstr=vernunft
Und hier meine 2012 Hits in den Rubriken, die keiner wissen wollte:
Vinyl 7″: Way Down Gone b/ Money (That´s What I Want) von The Perch Creek Family Jugband (Off Label Records)
Album Extraordinaire, das mich weiter begleiten wird: Andromeda Mega Express Orchestra/ Bum Bum/ Alien Transistor
Zeitungskolumne: Wiglaf Droste/ täglich in: junge Welt/ (kein Titel)
Blog: Peter Glaser/“Glaserei“
Film: Moonrise Kingdom
Fernsehn in Serie: Justified und gleichwertig 2broke girls
Musikbuch: HF Coltello/ Einige Abenteuer und seltsame Begegnungen im Leben des stillen Kommandeurs. Roman, Salis Verlag, 408 S., keine Fotos
(Colt mit links nicht Mutter, sondern Knarf Shakin Rellöm)
Retro Music Shiiittt: Hank Mobley & Lee Morgan
Selbstgehaltene Lesung: Nürnberg/ K4
Bestes immer noch nicht gekauftes Album: Gangstagrass/ Rappalachia (fuckin Import)
Längstes Telefonat: 71:22 Minuten, Mittsommernacht, mit dem Künstler Jochen Stenschke, mit dem ich schon befreundet war, als wir noch nicht zu sagen wagten, dass wir vielleicht lieber doch nicht Automechaniker bzw. Flugkapitän werden wollten. Wir diskutierten die meiste Zeit über mein aktuelles Lieblingsbild von ihm:
Hier mehr Abbildungen von ihm:
CATWALK SMALLTALK (VI)
Von Franz Dobler | 31. Dezember 2012 | Kategorie: Produktion, Unterhaltung | Kommentare deaktiviert für CATWALK SMALLTALK (VI)– Viel zu kompliziert, glaub ich dir nicht.
– Isso.
– Dein alter Herr war jenseits von soffisticatit.
– Kein vorehelicher Briefverkehr!
– Wie romantisch! Ich liebe ihn ins Grab hinein!
– Ja, ich auch.
– Schatz, du bist betrunken.
– Ja, ich auch.
BRECHTFESTIVAL AUGSBURG 2013 (2)
Von Franz Dobler | 30. Dezember 2012 | Kategorie: Literatur, Musik | Kommentare deaktiviert für BRECHTFESTIVAL AUGSBURG 2013 (2)„Ich brachte Nina Simone oft Eis. Sie war immer nett zu mir. Meist nannte sie mich >Daahling<. Ich brachte ihr ein großes graues Plastiktablett voll Eis, um ihren Scotch zu kühlen.
Sie schälte sich aus ihrer blonden Perücke und warf sie auf den Fußboden. Darunter war ihr echtes Haar kurz wie ein geschorenes schwarzes Schaf. (…) Sie wickelte sich ein blaues Handtuch um den Hals, beugte sich dann vor und stützte die Ellenbogen auf die Knie. Der Schweiß perlte ihr vom Gesicht und tropfte auf den roten Zementboden zwischen ihren Füßen.
Es war üblich, daß sie ihren Auftritt mit der >Piraten-Jenny< von Bertolt Brecht abschloß. Sie sang diesen Song immer mit einer derart eindringlichen Heftigkeit, als hätte sie den Text selbst geschrieben. Ihre Darbietung zielte direkt auf die Gurgel eines weißen Publikums. Dann zielte sie auf das Herz. Dann zielte sie auf den Kopf. Sie war mörderisch gut damals.“
– Sam Shepard. Motel Chronicles, S. 83
Man träumt schon seltsam schöne Dinge in diesen Rauhnächten…
BUKOWSKI SAGT
Von Franz Dobler | 30. Dezember 2012 | Kategorie: Literatur, Unterhaltung | Kommentare deaktiviert für BUKOWSKI SAGTIch schreibe in einem einfachen Stil und benutze nichtmal allzu viele Kraftausdrücke – weil ich dazu viel zu gottverdammt müde bin.
ZUM MITSINGEN VON HEIMATLIEDERN
Von Franz Dobler | 25. Dezember 2012 | Kategorie: Musik | Kommentare deaktiviert für ZUM MITSINGEN VON HEIMATLIEDERNkönnen Sie dieses Produkt verwenden. Zur genaueren Information zitieren wir ausreichend: „Neue Volksmusik-Instrumentals von traditionell bis gegen den Strich gebürstet. Aufmüpfige Blasmusik, träg-schräge Tuba, wilder Zieharmonika-Charme und „Bierleichen“. Tiefe bajuwarische Seele und freches Alpen-Crossover! Präsentiert von Harald & Uli Kümpfel („Der Bulle von Tölz“) …“
Abb. Koppiereit Nebraska Records
Wir sagen „denn man Tau“, wünschen allzeit besten Polizeischutz und wundern uns aber sauber, dass bei uns gestern in der Kirche ganz andere Lieder gesungen werden mussten („um eifrige Teilnahme wird dringendst gebeten!“):
1. Krinoline Blaskapelle # Rosen der Liebe 2. 3 Falkner # Urfahraner samma 3. Zitherquartett Manfred Schuler # Miesstaler Polka 4. Original Herberstein Trio # Dingl dangl Hammerstiel 5. Ringsgwandl # Leiner 6. Haidhauser Stubnmusi # Stofferl 7. Bruno S. # Nach der Heimat 8. G.Rag & Die Landlergschwister # I´ll never get out … 9. Wegscheider Musikanten # F-Dur Polka 10. Original Herberstein Trio # Es dauert nimma lang 11. Coconami # Chiemgauer Dreher 12. Hans Söllner # Reichenhall, meine Heimat 13. Karl Scherrer # Dreistettner Lied 14. Der Scheitl # When it rains in Texas 15. Ringsgwandl # Kneißl 16. Attwenger # Summa 17. 3 Falkner # Hansi Polka 18. Schlamminger/Pöschl # Ein Münchner in Summer.
Ees deafz ees glam, leicht woas need! Kein Wunder, dass man Nachwuchsprobleme hat.